Digitale Tischkultur soll Anorexie und Adipositas heilen: Das Mandometer
Geschrieben am 29. Oktober 2007 von KPBaumgardt
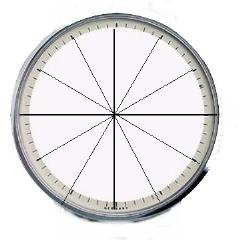 Ob wir ab einem BMI von 25+ künftig von der Gesundheitskasse einen „Mandometer“, einen Taktgeber für die Zufuhr der Häppchen, neben den mit Sensoren ausgestatteten Teller gestellt bekommen oder nicht, ist unter anderem eine Frage der Kultur: Der Tischkultur sowieso, aber auch der fortschreitenden Entfremdung und Fremdbestimmung.
Ob wir ab einem BMI von 25+ künftig von der Gesundheitskasse einen „Mandometer“, einen Taktgeber für die Zufuhr der Häppchen, neben den mit Sensoren ausgestatteten Teller gestellt bekommen oder nicht, ist unter anderem eine Frage der Kultur: Der Tischkultur sowieso, aber auch der fortschreitenden Entfremdung und Fremdbestimmung.
Die Apparatur, die Technik-affiine Ingenieure sich haben einfallen lassen, wäre jedenfalls bei einem funktionierenden sozialen Umfeld über-überflüssig; dass so etwas überhaupt entwickelt wird, wirft ein Licht auf die lieblosen und inkompetenten Zustände in den westlichen Familien.
Es führt wesentlich weiter, nach dem Sinn dieser „fortschrittlichen Technik“ zu fragen, als unter dem Motto „Gesund abnehmen und leben“ sie lediglich vorzustellen.
Das „Mandometer“ selbst weist ja darauf hin, dass es Personen gibt, die noch viel an Hilfestellungen und Kompetenz im Umgang mit sich und Anderen brauchen. Soziale Kompetenz braucht aber die soziale Auseinandersetzung, den Diskurs.
Update vom 06.01.2010:
Laut einer heute veröffentlichten Meldung hat das British Medical Journal eine Studie veröffentlicht, wonach das Mandometer bei Jugendlichen mit einem BMI über 30 akzeptable Erfolge erzielte.
Nach 18 Monaten konnte die Gruppe mit den Geschwindigkeitsmessern ihren BMI im Durchschnitt um 2,1 Punkte senken – etwa dreimal so viel wie die restlichen Teilnehmer.
Zudem hatten die Probanden in der Mandometer-Gruppe ihre Essgeschwindigkeit um elf Prozent gedrosselt, während sie in der Kontrollgruppe um vier Prozent gestiegen war. Gleichzeitig verringerten die Kontroll-Esser die Größe ihrer Portionen.
Die Verfasser des Berichts bezeichneten die Waage als geeignete Begleitmaßnahme bei der Behandlung übergewichtiger Minderjähriger. Sie ersetze allerdings nicht die übliche Therapie aus körperlicher Bewegung und Ernährungserziehung.
Abgelegt unter: Allgemein | 11 Kommentare »


 Die Herkunft der Irrsinnsidee, nur mit Kohl satt werden zu können und um ihn herum eine Diät zu „stricken“, werden wir wohl kaum mehr rekonstruieren können.
Die Herkunft der Irrsinnsidee, nur mit Kohl satt werden zu können und um ihn herum eine Diät zu „stricken“, werden wir wohl kaum mehr rekonstruieren können.
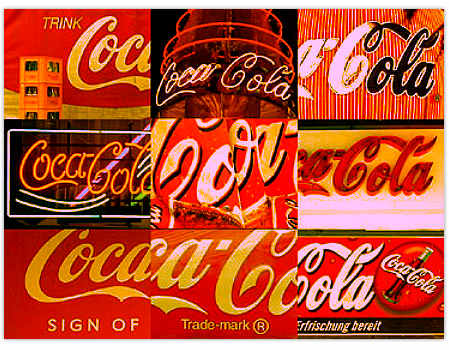
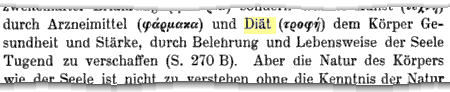
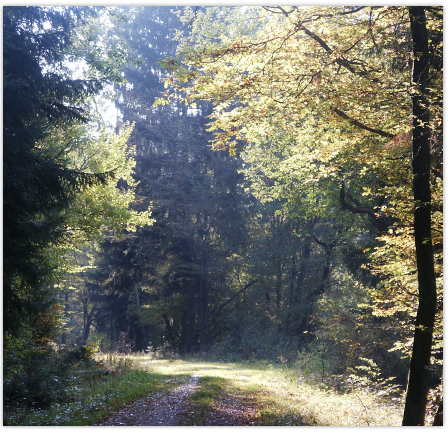
 Bei Darling Tian Ran Jian Fei, Lida Dai Dai Hua Jiao Nang, Meizitang, Miaozi fehlt auf der Verpackung der Hinweis, dass Sibutramin enthalten ist. Die Dosierung ist bei einigen Präparaten höher als bei uns zugelassen.
Bei Darling Tian Ran Jian Fei, Lida Dai Dai Hua Jiao Nang, Meizitang, Miaozi fehlt auf der Verpackung der Hinweis, dass Sibutramin enthalten ist. Die Dosierung ist bei einigen Präparaten höher als bei uns zugelassen.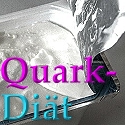
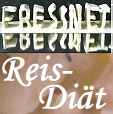

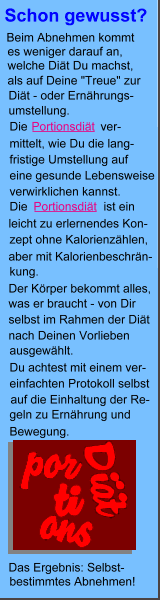
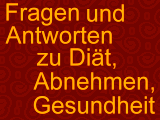
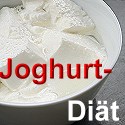

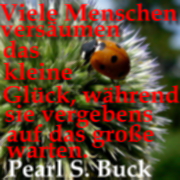

Frische Kommentare