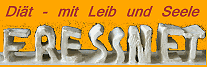Gemütszustände, Zustände des Gemüts
"Gemüt" setzt sich zusammen aus "Mut" und der Vorsilbe "Ge-".
Letztere macht aus einem Begriff einen Sammelbegriff, etwa bei Gebirge
(von Berg), Geschwister (von Schwester), Getier.
Der Mut wiederum leitet sich aus dem althochdeutschen 'Muot' ab:
"Kraft des Denkens, Empfindens, Wollens; Sinn, Seele, Geist; Gemüt(szustand).
Stimmung, Gesinnung; Übersicht."
Dass es Mut und Unmut gibt, man mutig oder mutlos sein kann, legt den
Gedanken an eine Skala des Muts nahe - mehrere Niveaus des Muts sind
parallel vorhanden - sonst hätten wir nicht den Sammelbegriff.
mutig
mutlos
|
übermütig |
furchtlos |
|
| heiter
|
tatkräftig |
| optimistisch |
zielstrebig |
| ausgeglichen |
|
| pessimistisch |
zurückhaltend |
| verstimmt |
ängstlich |
| verzweifelt |
phlegmatisch |
Eine weitere Reihung bezieht sich auf die Art des Muts;
| Anmut |
Edelmut |
|
Hochmut |
| "reizend" |
fürsorglich |
verletzend |
Wenn es dem Gemüt nicht so gut geht, hat wohl etwas aufs Gemüt
geschlagen, und es kommt darauf an, die "Gegenmächte" zu mobilisieren,
an denen Mut zu entwickeln ist.
Was es mit der Demut auf sich hat, wo die in die obeigen Reihungen
einzuodnen ist?
Hierzu ließen sich viele Zitate anführen, hier nur eine
Auswahl:
"Zwischen Hochmut und Demut steht ein drittes, dem das Leben gehört,
und das ist der Mut." - Theodor Fontane, Cécile
"Nur der Liebende ist mutig, nur der Genügsame ist großzügig, nur der
Demütige ist fähig, zu herrschen." - Laotse
"Rechte Demut weiß nimmer, dass sie demütig ist." - Martin Luther
Bei der Frage nach der Stimmung kommen die Antworten wieder aus dem
Bereich der Empfindungen: Man ist sauer, bitter, verbittert, fühlt
sich im positiven Fall gut oder prächtig; süß findet man eigentlich
nur Andere.
Die Stimmung wird vom Licht, von Farben, Bildern, Gerüchen,
Gedanken beeinflusst, davon, ob die Umgebung gemütlich
oder ungemütlich ist (worauf wir ja leidlich Einfluss nehmen können),
und von der Stimmung der Anderen, die mit uns leben. Eine angemessene
Umgebung, die Veränderungen erleichtert, gestaltet und anregt, hat eine
große Bedeutung.
Stimmung ist auch eine Angelegenheit von Gruppen, da soll man
umgestimmt werden, wird überstimmt und verstimmt, wenn die Harmonie
flöten gegangen ist.
Ein gutes Musikinstrument ist ordentlich gestimmt, Musik beeinflusst
auch unsere Stimmung und unser Gemüt - und es gibt honigsüße
Worte, die Musik in unseren Ohren sind
In der „Kritik der reinen Vernunft“ schreibt Kant:
“Die Überlegung (reflexio) hat es nicht
mit den Gegenständen selbst zu tun, um geradezu von ihnen Begriffe zu
bekommen, sondern ist der Zustand des Gemüts,
in welchem wir uns zuerst dazu anschicken,
um die subjektiven Bedingungen ausfindig
zu machen, unter
denen wir zu Begriffen gelangen können. Sie ist das
Bewußtsein des Verhältnisses gegebener
Vorstellungen zu
unseren verschiedenen Erkenntnisquellen,
durch welches allein ihr Verhältnis untereinander richtig bestimmt werden
kann.“ [Ibid., S.354]
August Bebel:
Man darf also sagen, daß in dem Maße, wie die Triebe und
Lebensäußerungen bei den Geschlechtern sich ausprägen, ... um so vollkommener
ist der Mensch, ... "Bei dem sittlichen Menschen", sagt Klencke in seiner
Schrift "Das Weib als Gattin", "ist allerdings der Zwang des Gattungslebens
unter die Leitung des... sittlichen Prinzips gestellt,... und wo gesunde
männliche oder weibliche Individuen dieser Pflicht gegen die Natur ...
nicht nachkommen, da war es ...die Folge sozialer Hemmungen und Folgerungen,
die ... krankhafte Richtungen und Zustände des Gemüts und Körpers
hervorrufen. Der Mann wird weibisch, das Weib männlich in Gestalt und
Charakter, weil der Geschlechtsgegensatz nicht zur Verwirklichung im
Naturplan gelangte, der Mensch einseitig blieb und nicht zur Ergänzung
seiner selbst, nicht zum vollen Höhepunkt seines Daseins kam."
Und Dr. H. Ploß sagt ... "Es ist im höchsten Grade bemerkenswert,...
daß es ein wirksames und niemals versagendes Mittel gibt, diesen Prozeß
des Verwelkens ... nicht nur in seinem Fortschreiten aufzuhalten, sondern
auch die bereits geschwundene Blüte ... wieder zurückkehren zu lassen,
nur schade, daß unsere sozialen Verhältnisse in den allerseltensten
Fällen seine Anwendung zulassen und ermöglichen. ... jeder Versuch der
Anpassung an Lebensverhältnisse, welche der Art nicht entsprechen, kann
nicht ohne bemerkenswerte Spuren der Degeneration an dem Organismus,
dem tierischen sowohl als auch dem menschlichen, vorübergehen."
Es entsteht nun die Frage: Erfüllt die Gesellschaft die
Anforderungen an eine vernünftige Lebensweise ... falls sie verneint
wird, entsteht die Frage: Kann sie dieselben erfüllen? Müssen aber beide
Fragen verneint werden, so entsteht die dritte: Wie können dieselben
erfüllt werden?

| zurück | weiter |
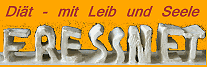
![]()